Michael Mann (Hg.)
Aufgeklärter Geist und evangelische Missionen in Indien
Vor zwei Jahren erschien im Draupadi Verlag der Band "Europäische Aufklärung und protestantische Mission in Indien". Der jetzt erschienene Fortsetzungsband möchte einige der Lücken schließen, die der erste Band im breiten Spektrum evangelischer Missionsinteressen hinterlassen hat. Beiträge zu Aufklärung und Missionsgedanke vertiefen den theoretischen Ansatz, während Aufsätze zur Herrnhuter Mission bis hin zu den Aktivitäten der Heilsarmee die praktische Arbeit vor Ort betrachten. Schließlich widmen sich einige Artikel den Auswirkungen der christlichen Lehre auf indische Reformbewegungen.
Inhaltsverzeichnis
Helmut Nanz und Christian Winkle: H.-G. Wieck zum Dank
Michael Mann: Einleitung
I. Aufklärung und evangelischerMissionsgedanke
Thomas Fuchs: Die Anfänge der protestantischen Missionsbewegung im 18. Jahrhundert
Hanco Jürgens: Am Scheideweg: Ansichten von Pietisten, Orthodoxen und Aufklärern zur Mission im 18. Jht.
II. Evangelische Missionsaktivitäten vor Ort
Martin Krieger: Vom „Brüdergarten“ zu den Nicobaren.
Die Herrnhuter Brüder in Südasien zu Beginn des 17. Jhts.
Heike Liebau: Zur Beförderung des Missionswerks und zum Nutzen der East India Company: Die Druckerei in Vepery/Madras in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Tilman Frasch: „Deliver their land from error’s chain.”
Mission und Kolonialherrschaft in Indien, 1793-1857
III.Kulturvermittler,Grenzgänger u. Weltverbesserer
Reinhardt Wendt: Visionärer Missionsstratege oder praxisferner Schreibstubengelehrter? Ferdinand Kittel und seine Studien zum südindischen Kannada
Jürgen Nagel und Christine Kracht: Die Begegnung der Herrnhuter Missionare mit dem tibetischen Buddhismus in Ladakh und Lahoul an der Wende zum 20. Jahrhundert
Harald Fischer-Tiné: »Meeting the lowest India on its own level«: Frederick Booth-Tucker und die Anfänge der Heilsarmee in Britisch-Indien (1882-1919)
IV. Wirkung und Folgen der evangelischen Mission
Frank Neubert: Die „andere“ Wirkung. Protestant. Mission in Indien und der entstehende Neo-Hinduismus im 19. Jht.
Andreas Nehring: Eine Art von Nicht-Ort: Marginalien aus den Missionsarchiven
Autorenverzeichnis und biographische Angaben
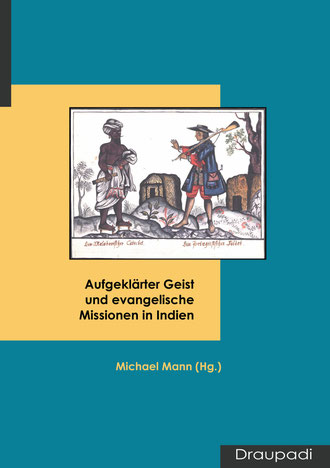
2008, 234 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-937603-29-2
Einleitung des Herausgebers
Als 2006 zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Dänisch-Englisch- Halleschen Mission (DEHM), die bekanntlich 300 Jahre zuvor im südindischen Tranquebar begonnen hatte, die Deutsch-Indische Gesellschaft e.V. (DIG) den Franckeschen Stiftungen zu Ehren ihre Jahreshauptversammlung in Halle abhielt, war zuvor die Frage aufgekommen, in welcher Form die DIG einen eigenen Beitrag zu diesem Jubiläum leisten könnte. Schnell waren sich die Mitglieder des Vorstands einig, unter meiner Leitung einen Sammelband herauszugeben, dem ich dann den Titel „Europäische Aufklärung und protestantische Mission in Indien“ gab. Beiträge für den Band einzuwerben bereitete keine Schwierigkeiten, eher kam es zu einem „Überangebot“. Einigen Autoren musste ich daher absagen, mit dem Gefühl, der Band zur protestantischen Indienmission aus historischer Perspektive würde unvollständig bleiben. Nun mag das im Rahmen von Sammelbänden nicht weiter wundern. Da jedoch konkrete Angebote zu Aufsätzen vorlagen, blieb die Idee eines zweiten, komplementären Bandes bestehen, der sicherlich nicht das letzte Wort gewesen wäre, wohl aber einen momentanen Gesamteindruck zur evangelischen Mission in Südasien geben kann.
Die Verabschiedung von Hans-Georg Wieck als langjährigen und höchst engagierten Vorsitzenden der DIG bot nun die Gelegenheit, den zweiten Band in Form einer Dankesschrift zu realisieren. Schnell waren die Autoren und Autorinnen gefunden. Ziel des zweiten Bandes ist es, alle im ersten Band hinterlassenen Lücken zu schließen und weiterführende Beiträge vorzulegen. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, eine „lange“ Einleitung als separaten Essay zu schreiben, wie das im ersten Band geschehen ist. An dieser Stelle soll vielmehr auf den komplementären Charakter des vorliegenden Bandes aufmerksam gemacht werden. Zwar ist jeder Band in sich geschlossen, nähme man aber die einzelnen Beiträge aus den beiden Bänden, dann ergäbe sich eine andere Reihenfolge und teilweise auch veränderte Rubriken. So ist denn diese Einleitung auch als Hilfestellung und Anregung zu einem „geordneten“ oder systematischen Lesen zu verstehen, ohne das Lesepublikum freilich entmündigen zu wollen.
Die Einleitung im ersten Band hat den Titel „Aufgeklärter Geist, philanthropische Bildung und missionarischer Eifer“ und versucht, einen Überblick über die geistes- und ideengeschichtliche Situation in Europa während des 17. und 18. Jahrhunderts zu geben, die dazu beigetragen hat, eine Mission seitens der Protestanten in Angriff zu nehmen. Daran schloss sich der weitergehende Beitrag „Überlegungen zum Verhältnis von Pietismus, Aufklärung und Mission im frühen 18. Jahrhundert“ an. In diesem Band knüpfen die Aufsätze von Thomas Fuchs und Hanco Jürgens an diesen Themenkomplex an. In seinem Betrag „Die Anfänge der protestantischen Missionsbewegung im 18. Jahrhundert“ kann Thomas Fuchs aufzeigen, dass mit der Krise der orthodoxen Gerichtspredigt nach dem Ende des ersten Krieges der Großen Allianz 1689-98 und dem Festhalten der Orthodoxie in ihrem Selbstverständnis als Territorialkirche eine religiös-theologische Herausforderung von großer Virulenz entstand, auf die der Pietismus radikal zu reagieren versuchte.
Wesentlich zur protestantisch-pietistischen Neubesinnung trug auch die europaweit empfundene und real existierende äußere Bedrohung des Protestantismus bei, wie sie sich 1685 durch die Aufhebung des Ediktes von Nantes und 1712 durch das Thorner Blutgericht manifestierte und zu großen Flucht- und Vertreibungswellen bei den Protestanten führte. Dieses Bedrohungsszenario schuf zusammen mit der überall nach den beiden Kriegen der Großen Allianz (1689-1713) zu verzeichnenden Pauperisierung und Verelendung der Bevölkerung gerade im deutschsprachigen Raum Mitteleuropas die Voraussetzungen für ein Christentum der mitleidenden Tat. Sein Charakteristikum bestand darin, dass es über die eigenen Gemeinden hinausging und letztlich die Grundlage für die weltweite Mission bereitete, mit der Christen und „Heiden“ im Auftrag einer inneren und äußeren Mission für den Protestantismus gewonnen werden sollten. Wie dieses Ausgreifen im Rahmen einer „europäischen Expansion“ argumentativ aufbereitet wurde, demonstriert der Beitrag von Hanco Jürgens „Am Scheideweg: Ansichten von Pietisten, Orthodoxen und Aufklärern zur Mission im 18. Jahrhundert“.
Um einen solchen Weg beschreiten zu können, mussten sich die Pietisten inhaltlich von den orthodoxen Lutheranern absetzten. Mit dieser „Befreiung“ war es jenen dann möglich, über die Bibelexegese die Begründung für eine protestantische innere wie äußere Mission zu liefern, die an Paulus orientiert auf apostolischen Füßen bewerkstelligt werden sollte. Fortan konnte und musste also auch in „Übersee“ missioniert werden. Freilich bedurfte es hier der besonderen historischen Konstellation, in der ein der Mission aufgeschlossener dänischer König und sein Hofprediger mit Verbindungen nach Berlin und damit auch ins preußische Halle an das „protestantisch-apostolische“ Personal kam. Dazu bieten im ersten Band die Einleitung und der Beitrag von Heike Liebau „Das Hallesche Waisenhaus und die Tranquebarmission“ einen erklärenden Einstieg. Wie vielfältig die missionarischen Aktivitäten und wie groß die anfänglichen Schwierigkeiten waren, auf die die Missionare stießen und die sie nur teilweise überwanden, zeigen der gerade genannte Beitrag von Heike Liebau und der hier abgedruckte Aufsatz von Hanco Jürgens.
An der Wende zum 19. Jahrhundert ist in Bezug auf religiöse Fragen zu beobachten, dass vor dem Hintergrund der fundamentalistischen Erweckungsbewegungen, wie sie in England ihren Ausgang nahmen, bei den DEHMaren in Indien einen Gesinnungs- und Wahrnehmungswandel stattfand, der mit einer zunehmenden Verengung der missionarischen Perspektive beschrieben werden kann. Wollte man den ersten Band als eine Geschichte der Indienmission vom interkulturellen Dialog zum rassistisch-kulturalistischen Monolog charakterisieren, so scheint es, dass die Evangelikalen-Bewegung und deren Ziel, die Mission auf ganz Britisch-Indien auszuweiten, entscheidend zu dieser perzeptionellen und missionsstrategischen Borniertheit beigetragen hat. Tilman Frasch beleuchtet mit seinem Aufsatz zu „Mission und Kolonialherrschaft in Indien, 1793 – 1857“ die territoriale Ausweitung der protestantisch-evangelikalen Missionsaktivitäten, die nicht zuletzt zur Entfremdung zwischen den britischen Herrschern und den neuen indischen Untertanen beigetragen hat, eine Entfremdung, die als eine der wesentlichen Ursachen für den indischen Befreiungskampf gegen die britische Kolonialherrschaft 1857-9 gesehen werden muss.
Nachdem es 1813 den Evangelikalen unter ihrem Sprecher William Wilberforce gelungen war, im Anschluss an die 1807 und 1811 verabschiedeten Gesetze zur Abschaffung des Sklavenhandels im Britischen Empire nun im englischen Parlament auch die Öffnung Britisch-Indiens für Missionare durchzusetzen, schienen die
Aussichten gut, sich mit neuem Eifer den Gesellschaften Südasiens zuzuwenden. Wie verblendet und hochfahrend dabei die sich zusehends radikalisierenden Protestanten in Indien auftraten, zeigt schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Beispiel des anglikanischen Priesters Claudius Buchanan. Allein dass die Vorsehung den Briten Indien hat zufallen lassen schien ihm Grund genug zu sein, von einer auch erfolgreichen Bekehrung der damals etwa 150 Millionen Inder und Inderinnen auszugehen. Doch nicht mehr die Bekehrung auf den pedes apostolorum, als vielmehr die Bildung mittels des gedruckten Wortes stand jetzt ganz oben auf der Agenda der Missionare. Sie sollte denn auch von der dänischen Niederlassung Serampur in Bengalen, wo sich neben den dänisch- halleschen Missionaren auch die der Baptist Missionary Society niedergelassen hatten, ihren Ausgang nehmen.
Während freilich die eine Seite der philanthropischen Medaille, die Abolition des Sklavenhandels, eher den humanitären und zugleich fortschrittlichen Aspekt der Europäer, insbesondere der englischen Zivilgesellschaft, demonstrierte, diente die andere Seite der Münze der Öffnung Britisch-Indiens für die protestantischen Missionare zur moralischen und materiellen Hebung der für rückständig erachteten indischen Bevölkerung, kurz: der Zivilisationsmission. Künftig stand christlich-bürgerliche Wertevermittlung auf der staatlichen wie missionarischen Bildungsagenda. Auf Bildungsinhalte als Standbein der Mission hatte sich bekanntlich schon die DEHM seit ihren Anfängen in Tranquebar konzentriert – die apostolische „Wandermission“ schien hingegen ein bloßes missionarisches Spielbein zu sein –, so dass man folglich für eine solch nicht wirklich neu formulierte Aufgabe bereits bestens gerüstet war. Der missionarische Impetus schien freilich ein anderer geworden zu sein. Eine wichtige Grundlage hierzu stellten die umfangreichen sprachwissenschaftlichen aber auch anthropologischen Beschäftigungen der halleschen Missionare in Tranquebar dar, wie dies im ersten Band die Beiträge von Gita Dharampal-Frick und Heike Liebau aufgezeigt haben.
Vor allem das gedruckte Wort, wie es nicht nur in den Grammatiken und Wörterbüchern zu südindischen Sprachen, sondern gerade in den Bibelübersetzungen vorlag, bildete die eigentliche Voraussetzung aller nun weiter reichenden missionarischen Bildungsaktivitäten. In Tranquebar betrieb die DEHM seit 1713 eine eigene Druckerei, die neben diesen wichtigen „Basistexten“ auch christliche Erbauungsliteratur produzierte und
gelegentlich Auftragsarbeiten der dänischen Verwaltung erledigte. Seit 1761 unterhielt die East India Company (EIC) in Verpery bei Madras eine Druckerei, die auch von der DEHM aus dem nicht weit entfernten Tranquebar genutzt wurde. Im Zuge der südindischen Erbfolgekriege stieg das englische Unternehmen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allmählich zur dominierenden Macht in Südindien auf, ein Prozess, der seinen vorläufigen Abschluss in der Vernichtung des Sultanats von Maisur 1799 fand, so im ersten Band im Aufsatz von Michael Mann zu Karnataka detaillierter nachzulesen. Mit der Expansion der britischen Territoroialherrschaft nahm auch der Bedarf an Verwaltungsformularen zu, so dass sich das Verhältnis von staatlich-administrativen Aufträgen an die Verpery-Druckerei und gelegentlichen Druckaufträgen für die DEHM umgekehrt zu dem in Tranquebar verhielt
.
Bislang wenig bedacht worden ist, dass die Druckerei in Verpery wohl ein wichtiges Verbindungsglied zur Druckerei im dänischen Serampur in Bengalen darstellt, von wo aus die britisch verwaltete Mughal-Provinz Bengalen mit Druckerzeugnissen ganz unterschiedlicher Art versorgt wurde, prominent darunter Schulbücher und, wie erwähnt, zunehmend auch christliche Erbauungsliteratur. Aber abgesehen davon war die Druckerei in Verpery mehr als 15 Jahre vor der überhaupt ersten Druckerei in Calcutta dazu gezwungen, als staatliches Unternehmen nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu operieren. In jedem Fall belegt die Achse Verpery/Madras – Serampur/Calcutta, dass den südindischen Druckereien sowohl in Tranquebar als auch in Verpery, wobei letztere über Jahre hinweg als Gemeinschaftsunternehmen von DEHM und EIC geführt wurde, im Rahmen des in Südasien europäisch dominierten Presse- und Druckgewerbes mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, will man die Verbreitung von Druckerzeugnissen bei der missionarisch geprägten Schulbildung in Bengalen historisch angemessen verorten.
Die Missionsstation der DEHM in Tranquebar strahlte indes nicht nur auf dem indischen Subkontinent aus, sie diente auch als Ausgangspunkt für die Mission der Herrnhuter auf den im Golf von Bengalen gelegenen Nikobaren. Ist im ersten Band diese Mission im Detail geschildert worden, so wird im hier nun abgedruckten Beitrag von Martin Krieger „Vom 'Brüdergarten' zu den Nicobaren. Die Herrnhuter Brüder in Südasien zu Beginn des 17. Jahrhunderts“ ein umfassenderes Bild der Herrnhuter-Mission gezeigt, wie sie sich im Windschatten der DEHM von Tranquebar aus entwickelte. Vor den Toren der Stadt im so genannten Brüdergarten angesiedelt, war sie dort eher geduldet als in eine breit angelegte protestantische Mission integriert. Von einer solchen war aber ohnehin nie die Rede, auch weil 1771 vom dänischen König Christian VII. (reg. 1766-1808) der Auftrag zur Nikobarenmission direkt an die Herrnhuter ergangen war. Da der Brüdergarten als Basisstation unmittelbar an der Mission der Nikobaren hing, war abzusehen, dass hier mit dem Fehlschlag der Mission 1786 auch dort das Ende schnell eintreten würde.
Nicht besser erging es der Herrnhuter Mission in Zentralasien, wie der Beitrag „Die Begegnung der Herrnhuter Missionare mit dem tibetischen Buddhismus in Ladakh und Lahoul an der Wende zum 20. Jahrhundert“ von Jürgen G. Nagel und Christine Kracht belegt. Im Rahmen ihrer weltweiten Missionsbemühungen hatten die Herrnhuter den ersten Plan zu einer Mongolenmission, der aus dem 18. Jahrhundert datiert, nicht aufgegeben. Realisiert werden konnte er, als das Chinesische Reich nach dem Opiumkrieg beim Friedensschluss 1842 mit Großbritannien ausgewählte Vertragshäfen für den internationalen Waren- und Personenverkehr öffnen musste. Auch die territoriale Expansion des russischen Zarenreiches in Richtung der zentralasiatischen Chanate spielte eine wichtige Rolle. Allerdings erfolgte die Anreise der Herrnhuter Missionare aus Britisch-Indien, von wo man allein Zugang zu Tibet erhalten konnte. Wieder war es Schulbildung, die das Standbein der Mission bildete, zusammen mit der medizinischen Versorgung, die seitens der Missionare offensichtlich als überlegene zivilisatorische Errungenschaft angesehen, zu ihrer großen Enttäuschung von den Tibetern aber nur ergänzend verwendet wurde.
Auch die „Mongolenmission“ scheiterte, was nicht nur die geringen Bekehrungserfolge anzeigen, sondern ebenso der geringe Nachhall, den die Anwesenheit der europäischen Missionare im Himalaya hinterlassen hat. Wie seit den Anfängen der protestantischen Mission in Tranquebar ist auch für die in Ladakh zu konstatieren, dass langfristige und dauerhafte Erfolge allein auf wissenschaftlichem Gebiet aufgehäuft werden konnten, weil nach westlichem Verständnis umfangreiche und erstmalige linguistische, religionswissenschaftliche und anthropologische Studien angefertigt wurden. Freilich gehörten solche Studien nicht zu den dringlichsten Aufgaben einer Mission, was schon Bartholomäus Ziegenbalg und nun auch den Herrnhuter Missionaren in Tibet herbe Kritik seitens ihrer Missionsleitungen in Deutschland einbrachte. Immerhin zeitigte die Herrnhuter Mission in Tibet wenn schon keinen missionarischen, dann aber einen akademischen Erfolg. Darin unterscheidet sie sich von dem Debakel der Mission in Südindien und den Nikobaren, die auf der ganzen Linie gescheitert war.
Herbe Kritik wegen seiner für seltsam und eigensinnig erachteten Amtsauffassung musste auch Ferdinand Kittel erfahren, den die Basler Mission Mitte des 19. Jahrhunderts nach Südindien schickte. Der Beitrag von Reinhardt Wendt „Visionärer Missionsstratege oder praxisferner Schreibstubengelehrter? Ferdinand Kittel und seine Studien zum südindischen Kannada“ schließt an den Aufsatz von Katrin Binder zur „Basler Mission in Karnataka und Kerala“ aus dem ersten Band an. Wie Bartholomäus Ziegenbalg wollte auch Ferdinand Kittel sich verstärkt auf ortsansässige Bräuche einlassen, um so den Menschen näher zu kommen und sie so überhaupt für die Bekehrung gewinnen zu können. Grundlage dafür bildete für ihn immer mehr die Sprache Kannada, wie sie im heutigen indischen Bundesstaat Karnataka gesprochen wird. Kittel schuf mit seinen linguistischen Studien und seinem Wörterbuch aus dem Jahr 1894 Kannada (oder Kanaresisch) als Standardsprache, was ihm heute in Karnataka weithin Anerkennung einbringt, im deutschsprachigen Raum jedoch nur die Indologen mit Respekt zur Kenntnis nehmen.
Ähnlich war es bekanntlich Adoniram Judson ergangen, der als einsamer Vertreter der Baptist Mission Society in Birma grundlegende Missionsarbeit betrieb und dabei das bis heute nahezu uneingeholte Wörterbuch zur birmanischen Sprache schuf, wie Tilman Fraschs Beitrag im ersten Band schildert. In Birma wie in Tibet und zu Teilen auch in Karnataka war der Erfolg der evangelischen Missionen, selbst bei noch so engagierten Personen, recht bescheiden, nimmt man allein die Bekehrungsstatistiken als einen Indikator. Immens ist hingegen der sprachwissenschaftliche und teilweise anthropologische Ertrag. Generell ist jedoch zu beobachten, dass mit fortschreitender Zeit die breit gestreuten wissenschaftlichen Interessen, wie sie gerade die Missionare der DEHM anfänglich ausgezeichnet hatten und den Grundstock zu manch wissenschaftlicher Sammlung in Deutschland lieferten, deutlich nachließen und sich um die Wende des 20. Jahrhunderts fast ausschließlich auf linguistisch-philologische Studien beschränkten. Auch auf wissenschaftlichem Gebiet ist demnach eine Verengung der Aktivitäten zu beobachten.
Solch wissenschaftliche Ambitionen verfolgte die Salvation Army in Britisch Indien von Beginn ihrer Missionstätigkeiten nicht. Sie konzentrierte sich allein auf eine Zivilisationsmission, die die Vermittlung moralischer und sittlicher Werte zum Ziel hatte. Der Gründer der Heilsarmee, William Booth-Tucker, hatte sich zunächst der Hebung des von der viktorianischen Gesellschaft als degeneriert und verroht charakterisierten englischen ‚Lumpenproletariats’ verpflichtet. Zur inneren Mission kam bald die äußere, sprich überseeisch-koloniale Mission, deren Personal Tucker aus den „Geretteten“ rekrutierte. Durchaus neue missionars-strategische Akzente setzend befürwortete Tucker das so genannte „going native“, das von der Annahme indischer Kleidungs- und Ess- bis hin zu Lebensgewohnheiten reichen konnte. Zugleich entwickelte Tucker eine höchst aggressive Missionstaktik, nach der er mit pompösen Fanfarenzügen in abgelegene Adivasi-Dörfer einzog, was bisweilen die beeindruckte Bevölkerung kollektiv zum Christentum übertreten ließ. Beides, Strategie und Taktik, war in den Augen der britischen Kolonialbehörden zunächst äußerst umstritten, denn das eine drohte die Grenzen zwischen Kolonisierern und Kolonisierten zu verwischen, das andere massiv den inneren Frieden zu stören.
Zur reinen Missionstätigkeit kam bald ein ausgeprägt karitatives Engagement. Schließlich gelang Tucker der Durchbruch bei den britischen Kolonialbehörden, als die Salvation Army mit dem höchst ambitiösen Projekt zur Überwachung und Umerziehung der so genannten „Criminal Tribes“ beauftragt wurde. In Arbeitslagern (Industrial Homes) erhielten die als von Geburt an oder durch die indische Sozialordnung prädestinierte angeblich kriminelle Gesellschaften schließlich eine Erziehung, die letztlich der Integration in die industrielle Arbeitswelt diente. Und zu guter Letzt nahm sich die Salvation Army zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch noch des europäischen Proletariats in der indischen Kolonie an, vor allem der Landstreicher. Sie störten erheblich das selbst gemalte Bild der erhabenen weißen Herrscherrasse und verschwanden daher zumindest aus dem öffentlichen Straßenbild in den von der Heilsarmee geführten Arbeitshäusern. Wie an kaum einer anderen Stelle kollaborierte eine protestantische Missionsorganisation so eng mit kolonialstaatlichen Institutionen wie im Rahmen der Sozialdisziplinierung indischer Gesellschaftsgruppen um die Wende zum 20. Jahrhundert, was der Aufsatz von Harald Fischer-Tiné eindringlich vor Augen führt.
Kaum erwähnt wurden im ersten Band die indischen Reaktionen auf die verstärkten Aktivitäten der evange-lischen Missionen seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Aufsatz von Frank Neubert „Die 'andere' Wirkung. Protestantische Mission in Indien, der Brahmo Samaj und der entstehende Neo-Hinduismus im 19. Jahrhundert“ erläutert an drei prominenten Personen, wie ein Teil der indischen Elite auf die missionarischen Umtriebe reagierte. Rammohan Roy, der vielleicht bekannteste bengalische Reformer, versuchte in seinen philosophisch-religiösen Schriften, Jesus als eine ethisch-moralische Instanz zu etablieren, der jedoch kein göttlicher Status zukam. Dass Roy damit das große Missfallen der Missionare erweckte, kann nicht verwundern. Unter Missionstheologen löste Roy eine heftige Debatte aus, die in Indien wie in Europa geführt wurde. Indes liegt die Vermutung nahe, dass Rammohan Roy, dessen Name eng mit dem Beginn der „Bengal Renaissance“ in Verbindung gebracht wird, zwar Reformen in Bengalen befürwortete, aber keinesfalls im Sinn der Europäer, deren Historiographie Roy unter Umständen falsch interpretiert und zu Unrecht in ihrem Sinn deutet und darüber vereinnahmt.
Eines der interessantesten Ereignisse der „Missionsgeschichte“ ist sicherlich im Auftritt Swami Vivekanandas vor dem Weltparlament der Religionen zu sehen, das im Rahmen der 1893 in Chicago stattfindenden Weltausstellung tagte. Eigentlich verfolgten die Organisatoren mit dem Kongress die Absicht, die Überlegenheit des Christentums gegenüber den anderen Weltreligionen Islam, Buddhismus und Hinduismus vorzuführen. Unverhofft präsentierten sich die Vertreter dieser Religionen jedoch so souverän, was nicht zuletzt an ihren elaborierten Reden und den darin geäußerten Ideen lag, dass genau der gegenteilige Effekt eintrat. Zum ersten Mal dürfte vor einem Weltpublikum ersichtlich geworden sein, warum es trotz aller Bemühungen seitens protestantischer Missionsgesellschaften so wenig Bekehrungserfolge zu verzeichnen gab und warum in den integrierenden und inkludierenden Reformbewegungen gerade in Südasien die eigentliche Stärke der dortigen Glaubensformen lag. Zu Vivekanandas Erfolg hat sicherlich auch sein Vorschlag beigetragen, der Osten solle seine „spirituellen Weisheiten“ dem Westen vermitteln, während umgekehrt der Osten von der rationalen Organisation der westlichen Gesellschaften lernen könne.
Was aber ist überhaupt der „Osten“ oder „der Orient“, was ist er geographisch, politisch, gesellschaftlich und religiös? Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem der abschließende Beitrag von Andreas Nehring „Eine Art von Nicht-Ort: Marginalien aus den Missionsarchiven“. Rekurrierend auf die Schriften von Edward Said
und Gayatri Spivak zeigt der Beitrag auf, wie im 19. und 20. Jahrhundert bestimmte Elemente aus der Vielfalt der indischen Glaubensformen zu dominanten, den Hinduismus als Religion definierende und konstituierende Elemente entwickelt worden sind, während der „unbrauchbare Rest“ marginalisiert wurde. Gewährsmann dieses Prozesses, der auch als „mapping“ oder „worlding“ bezeichnet wird, ist der deutsche Missionar Carl Ochs, der mit seinen zahlreichen geographischen, ethnographischen und kulturell-religiösen Berichten in den „Nachrichten aus Ostindien“ im Verlauf der 1860er Jahren zwar ein Publikationsforum besaß, das jedoch kaum zur Kenntnis genommen wurde und auf international- wissenschaftlicher Ebene wohl keinerlei Bedeutung besaß.
Bei aller post-kolonialer Skepsis, die gegenüber den archivierten Dokumenten aufgebracht werden muss, ist Carl Ochs mit seinen Überlieferungen zweifelsohne ein Repräsentant der Marginalisierten, wenn er einerseits die Vielfalt des südindischen „Volkskatechismus“ betont, der eben nicht in das „majorisierte“ Schema des brahmanischen Hinduismus passt(e), andererseits aber den wilden Aberglauben des Volksglaubens massiv kritisierte, was aus seiner Sicht als Missionar durchaus nachzuvollziehen ist. Einher mit dieser Ausgrenzung ging die Reduzierung der überlieferten altindischen Literatur auf Sanskrit-Texte, allen voran den Vedischen Schriften. Sämtliche anderen Formen der schriftlichen Überlieferungen, besonders der Purana, sind im Zuge dieser „Brahmanischen Renaissance“, wie sie von den europäischen Indologen, namentlich der französischen und deutschen, und den britischen Kolonialadministratoren gleichermaßen betrieben wurde, nicht in den Kanon indischer Literatur(en) aufgenommen worden. Für südindische „Volkskatechismen“, wie sie Carl Ochs formulierte, gab es keinen Platz mehr.
Einmal mehr dürfte deutlich geworden sein, dass einzelne protestantische Missionare vor Ort nicht im Sinn der Missionsleitung arbeiteten oder dass sie, wie das letzte Beispiel zeigt, schlicht marginalisiert und aus der Geschichte herausgeschrieben wurden, weil sie nicht ins Mehrheitsbild passten oder sich in dieses nicht einfügen lassen wollten. In verschiedenen Beiträgen beider Bände, die nun vorliegen, kommt diese Spannung zwischen der Leitung einer Missionsgesellschaft und einigen wenigen ihrer Missionare vor Ort zum Ausdruck. Sicherlich existierte eine generelle Missionsstrategie, die sich in konkreten Aufgaben niederschlug, allen voran der missio per pedes apostolorum sowie der Bildung und Erziehung. Allzu oft und bisweilen recht schnell stießen die Missionare in Südasien bei beiden Strategien an ihre Grenzen und versuchten, eigene Vorgehensweisen zu entwickeln, nicht immer zum Gefallen der Missionsleitungen.
Wollte man polemisch das wesentliche und wichtigste Ergebnis aller evangelischen Mission in Südasien vom Beginn des 18. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts herausstreichen, so lag es ohne Zweifel in der linguistisch-wissenschaftlichen Erschließung von Regionen wie Karnataka, Tamil Nadu, Birma und Tibet. Von Erfolgen auf dem Feld der Bekehrung lässt sich kaum sprechen, eher von den Impulsen, die von den Inhalten des Christentums ausgingen und im 19. Jahrhundert dazu führten, dass bengalische und andere südasiatische Gesellschaftsreformer einzelne Aspekte des Christentums aufnahmen und sie selektiv in die eigenen sozial- religiösen Reformideen integrierten. Weniger taucht dabei die Frage auf, ob es sich hier um „überlegene“ moralisch-ethische Prinzipien wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit handelt, als vielmehr die Frage, welche Elemente der christlichen Lehre(n) adaptions- und integrationsfähig waren – womit die Handlungskompetenz („agency“) nicht bei den europäisch-amerikanischen Missionaren, sondern bei den indischen Reformern lag.
Offensichtlich basierten die Gesellschaften Südasiens mehrheitlich auf funktionierenden und stabilen Institutionen, die es verhinderten, dass die evangelisch-protestantische Mission auf breiter Front erfolgreich eindringen und zerstörerisch wirken konnte. Dies gelang und gelingt den christlichen Missionen nur dort, wo gesellschaftlich-ökonomische Spannungen die Lücke aufreißen, so beispielsweise in den Regionen, in denen Adivasi und Dalit leben, in die die Missionare mit dem Christentum als alternativer Religion und vorgeblich neuer, egalitärer Gesellschaftsordnung hinein stoßen können. Gewaltsame Ausschreitungen gegen missionarische, aber auch kulturelle und karitative Institutionen bis hin zu Krankenhäusern, die von europäischen nicht-missionarischen Trägern finanziell und personell unterstützt werden, sind tragischer Ausdruck von verschärften oder sich zuspitzenden sozialen und politischen Verhältnissen.
Nicht übersehen werden darf dabei, dass die besagten indischen Gesellschaften oder gesellschaftlichen Gruppen wie auch die Europäer hier indirekt Opfer von teilweise höchst aggressiv auftretenden amerikanisch-australischen Missionaren werden – offensichtlich haben die umstrittenen Methoden und negativen
Erfahrungen der Salvation Army vor gut einhundert Jahren keinerlei Wandel in Gesinnung und Strategie bei den aggressiven Christenmachern bewirkt. Gerade dieses Vorgehen veranlasst wiederum hindu-nationalistische Aktivisten dazu, sich mit gewaltsamen Übergriffen bisweilen unterschiedslos gegen alle „westlich-christlichen“ Institutionen und Personen zu wehren, nicht zuletzt, um daraus auch eigenes politisches Kapital zu schlagen. Christliche Mission scheint demnach nicht auf allen Ebenen und in allen Regionen zum Frommen der wenigen Missionierten zu verlaufen und schlägt bisweilen undifferenziert, aber zielgerichtet gegen ihre Repräsentanten zurück.
Erhältlich in jeder guten Buchhandlung oder direkt beim Verlag unter Bestellungen!
