Alokeranjan Dasgupta
Mein Tagore
Eine Annäherung an den indischen Dichter Rabindranath Tagore
Der Nobelpreisträger Rabindranath Tagore (1861-1941) war in den 1920er Jahren in Deutschland sehr populär. Anlässlich seines 150. Geburtstages wird er von Alokeranjan Dasgupta neu entdeckt.
Eine persönliche Annäherung mit einer Auswahl von Gedichten und Prosaskizzen Tagores.
Mein Tagore
Versuch einer Neubewertung
Als mein Freund Lothar Lutze mich aufforderte, einen Monolog über meinen Tagore zu halten, war der erste spontane Gedanke, der mir durch den Kopf ging, die Sequenz einer solchen Aufgabe einfach umzukehren und über seine Rolle in meinem Leben zu sprechen. Denn hier geht es um einen Mann, der maßgeblichen Anteil daran hatte, das Muster meines Lebens zu modulieren, die Nische meines innersten Seins und Werdens zu formen. Hier ist eine Art Determinismus am Werke.
Während ich über meine Reaktion auf bestimmte, phänomenale Stimuli nachdachte, schien es mir oft, dass es Rabindranath Tagores charakteristische Art war, der Wirklichkeit zu begegnen, die mich unweigerlich beeinflusst hatte. Schlagartig wurde mir – mit einem Gefühl des Schauderns – bewusst, dass er alle Bereiche meines Lebens beeinflusste, wenn nicht sogar meinen Lebenslauf vereinnahmte.
Wer Tagore nicht kennt, könnte dies als eine Art Übergriff von Seiten Tagores bezeichnen – im Hinblick auf die Tatsache, dass er, wenngleich er auch einige biografische Stücke schrieb, die Form einer
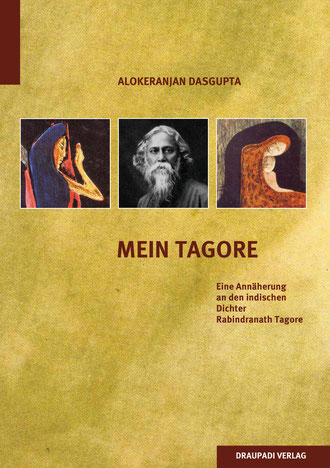
2011, 126 Seiten, 12,80 Euro, ISBN 978-3-937603-48-3
Lebensbeschreibung im Kontext der Kunst doch nie ganz ernst nahm. Denn er behauptete, ein wirkliches Gedicht transzendiere seinen Stoff, und er verglich ein Poem mit einem Tautropfen, der – ohne jegliche Rückerinnerung an seine Herkunft – Einzigartigkeit besitzt.
Tagores kritische Haltung gegenüber der üblichen Überbewertung seiner Vita ermutigt uns heute, hier in Darmstadt – wo paradoxerweise vor 71 Jahren seine Kunst von seiner legendären Persönlichkeit völlig in den Schatten gestellt wurde – den Versuch einer Neubewertung zu unternehmen.
Wie die meisten Menschen Darmstadts während der Tagore-Woche 1921 geradezu mesmeriert waren, wurde ich selbst während meiner Kindheitstage in seinem Ashram, Santiniketan, ein verletzbares Opfer der
Legende des Propheten, genannt Tagore, und räumte damals seinem kreativen Schaffen vielleicht nur den zweiten Rang ein. Als ich vor kurzem Holger Pauschs literarische Biographie über Paul Celan las, einen Dichter, der heute – als Dichter – eine größere Bedeutung in meinem Leben erlangt hat als Tagore, stieß ich auf die lakonischen Anmerkungen des Autors über Biographisches, Sekundäres. Offenbar ist diese – geringschätzige – Beurteilung des Biographischen mit Tagores diesbezüglicher Einstellung vergleichbar. Als ich dann aber zwischen den Zeilen las, fand ich, dass der Autor dies tat, weil die meisten Fakten über Paul Celans Leben unwiederbringlich verloren gegangen sind. Das war der Grund, der ihn veranlasste, sich ausschließlich auf seine Dichtung, die sich wie Hieroglyphen liest, zu konzentrieren. Anders bei Goethe und Tagore. Jahrbücher wie: Mit Goethe durchs Jahr werden stets revidiert, um jeden Augenblick seines illustren Lebens festzuhalten. Ähnlich beschäftigen Hunderte von bio-bibliographischen Annalen über Tagore – damals wie heute – die Druckerpressen, so dass wir jede Begebenheit seines Lebens beinahe auswendig wissen. An und für sich ist das kein Fehler. Etwas aber wird hier vorsätzlich missverstanden: Viele der sublimierenden und stilisierenden Ingredienzen werden in einen Topf geworfen, um ihn größer erscheinen zu lassen, als er war. Lange zuvor lehrte uns Keats, dass menschliche Größe als solche nichts mit Dichtkunst zu tun habe. Bengalische Tagore-Biographien irritieren mich jedoch immer wieder durch ihre peinliche Tendenz, den ansonsten großen Mann durch einen allegorischen Überbau zu glorifizieren. Auf diese Weise bagatellisieren sie die Größe seiner Dichtung.
Die Tagore-Euphorie in Europa und anderswo, wurde – sowohl von Stephan Zweig, wie auch kürzlich von William Radice – zutreffend als Idolatrie und Bardolatrie angeprangert.
Als Kind fiel ich nur allzu leicht dieser Art prismatischer Rezeption zum Opfer. Als 8-jähriger Junge konnte ich aus unserer Wohnung in Süd- Kalkutta einen Blick auf den endlosen Trauerzug mit dem Leichnam Tagores werfen. Ich weinte bitterlich und fühlte mich gedrängt, meine elegische Reaktion in einem Gedicht festzuhalten. Am nächsten Morgen musste ich dann beschämt feststellen, dass die meisten bengalischen Zeitungen den Trauerzug in blumigen Diktionen beschrieben. Ich zerriss mein prosaisches Gedicht über den Tod eines Dichters.
Das war 1941: in dem Jahr, in dem Rabindranath Tagore, James Joyce und Virginia Woolf starben. In späteren Jahren bedeuteten mir die beiden anderen Namen viel, und es ist als reiner Verehrungsakt zu sehen, dass ich die göttliche Hierarchie außer Acht ließ, die Tagore einen höheren Rang vor den beiden anderen einräumte. Das hätte in jenen Tagen als ungeheuerliches Sakrileg gegolten. Ich konnte von Glück sagen, dass ich Tagore nicht zu seinen Lebzeiten erfahren hatte. In diesem Falle wäre es denkbar gewesen, dass ich ihm völlig ausgeliefert gewesen wäre, ohne jegliche Konturen meines eigenen Selbst – wie viel kleiner meine Dimensionen, verglichen mit den seinen, auch sein mochten.
Es war im Jahre 1946, als ich zum ersten Mal nach Santiniketan kam und sofort als Schüler der Pathabhavan – der 6. Klasse – zugelassen wurde, ohne irgendeinen starren Auswahltest bestehen zu müssen. Dieser Liberalismus war ganz nach Tagores Prinzipien, die jungen Menschen die Türen öffneten, um ihnen die Chance zu geben, sich selbst zu entfalten, inmitten einer Naturumgebung und ohne jeglichen Examensstress und strenge Zensuren.
Der erste Text, mit dem uns unser Geschichtslehrer bekannt machte, stammte von Tagore und übte auf uns die Wirkung einer Zauberformel, einer Beschwörung, aus:
Der Mensch ist zügellos. Als er in den Wäldern hauste, bestand zwischen ihm und der Natur eine harmonische Wechselbeziehung. Als er aber zum Stadtbewohner wurde, verlor er jedes Gefühl für den Wald. Dieser Mensch fällte den Baum, der ihm einst Gottes Gastfreundschaft geschenkt hatte, nur um sein Stadthaus aus Holz und Ziegeln zu errichten. ...
Jetzt aber ist der Wald gestorben. Und eine große Gefahr ist im Anzug. Dieses Problem besteht nicht nur in Indien. Überall auf der Welt ist es heute schwieriger geworden, die Waldschätze vor der Gier der Menschen zu beschützen. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden riesige Waldgebiete einfach gerodet. Deswegen gibt es dort Sandstürme, die den Ackerbau schädigen und unter sich begraben. ...
Wir waren einfach fasziniert vom Zauber der bengalischen Prosa, ohne zu bemerken, dass dies eigentlich unsere erste Ökologie-Lektion war, die heute so unverzichtbar aktuell ist. Gleich am ersten Abend wurden wir zu der grande dame, Indira Devi Chaudhurani, geleitet, um in Rabindrasangit, d.h. die von Tagore komponierten Lieder, eingeführt zu werden. Indira war eine Nichte Tagores und galt als Schlüsselperson zu Tagore.
Vielleicht war es eine rein zufällige Korrelation, dass sie damals das Lied amara parana loye ki khela khelabe / ogo paranapriya sang, das Tagore 1921 auch in Darmstadt gesungen hatte.
Es wäre ein seltsamer Vorsatz, ein Tagore-Lied aus der bengalischen Sprache selbst ins Bengalische übertragen zu wollen. Ich würde das nicht versuchen. Sollte die Bedeutung jenes Refrains irgendwie paraphrasiert werden, könnte es folgendermaßen sein:
Was für ein Spiel treibst du mit mir, du Gebieter meines Lebens?
Seit ich dieser Botschaft zum ersten Mal verfallen war, ging sie mir – so muss ich hier in aller Offenheit bekennen – nicht mehr aus dem Kopf. Und das war der Anfang eines Rendezvous mit meiner Bestimmung. Denn seit dieser Zeit scheint mir Tagore als eine Art entscheidendes, wenngleich beschwörendes Wesen, welches in mir und meiner poetischen Intention ein Chaos anrichtete.
Während einer der ersten einführenden Lektionen in das Sanskrit lehrte uns Nityananda Vinod Goswami, unser stets geistesabwesender Lehrer, die Etymologie des Begriffes bhakti. Er wiederholte damals, dass bhakti nicht gedankenlose Unterordnung der Anhänger bedeute. Was es wirklich ausdrückt, ist das Aufspalten des einen in zwei Komponenten – und dass es die spielerische Dialektik zwischen diesen beiden Entitäten sei, auf die es in bhakti wirklich ankomme.
Später fand ich dann eine Entsprechung der Dualität Liebe – Verehrung auch in der Mystik des St. Johannes vom Kreuze. Damals aber wusste ich nichts davon und hielt es für angemessen, meinen Willen im Geiste völliger Hingabe Tagore unterzuordnen. Eine Trennung zwischen dem Osten und dem Westen gab es einfach nicht. Das Motto des Visvabharati Ashram, in dem ich gelandet war, ist Yatra visvam bhabatyekanidam („Wo die Welt zu einem einzigen Nest wird“). Diese Welt-Vision wurde hier ganz deutlich, ich war frei wie ein flüchtiger Vogel, dem ein Visum in einem Zufluchtsort, der sich Ashram nannte, erteilt wurde. So konnte ich meinen selbststilisierten Flug selbst bestimmen. Doch fand ich mich in dieser Freiheit gefangen. Im Deutschen gibt es ein wunderbares Wort, Spielraum. Ich hatte diesen Freiraum, und doch muss ich zugeben, dass ich nicht in der Lage war, meine eigene Wahl zu treffen. Die Atmosphäre der Einsiedelei war durch die frischen Erinnerungen an Tagore geprägt. Selbst sein kürzlicher Tod schien verlockend und beschwor uns dennoch zu äußerstem Gleichklang mit dem allumfassenden und alles in Frage stellenden Geist Tagores. Das Ergebnis war, dass ich mich ihm in die Hände gab und mich damit seinen auf mich hermetisch wirkenden Texten auslieferte. Dabei hatte ich ziemlich häufig ein schlechtes Gewissen, wenn ich – empirisch gesehen – nicht mit ihnen übereinstimmte. Ich fühlte mich schuldig, wenn ich einen Gedanken hatte, der nicht mit dem übereinstimmte, wie Tagore ihn artikuliert hätte. Er wurde mein Richter im alttestamentlichen Sinne des Wortes, der mich plötzlich auslöschen würde, wiche ich ab von seinem Weg, die Dinge in die richtige Ordnung zu setzen.
Eigene Gefühle zu intonieren, auf ganz bestimmte, präzise Art, das war das Ambiente von Santiniketan. Und das bedeutete mir viel. Zurückblickend muss ich bekennen, dass ich hierdurch etwas lernte, das bis heute eine Art Richtschnur für mich blieb. Das Bengali-Wort für mein damaliges Gefühl ist vani, was „eine Botschaft“ bedeutet, aber auch mitbezeichnend für einen Text aus semiotischem Gewebe steht. Es war während eines bedeutungsvollen Zeitpunkts, dass Mahatma Gandhi nach Tagores Tod die Verantwortung für Santiniketan übernommen hatte. Dies war seine letzte Reise zu diesem Ashram – der so weitaus komplizierter war als seine eigenen linearen Sabarmati- und Sevagram-Ashrams –, bevor er von einem Hindu-Fanatiker niedergeschossen und getötet wurde. Gandhi erzählte uns, während er mit uns spielte, an einem Nachmittag in reinem Bengali: amar jivan amar bani, d.h. „Mein Leben ist meine Botschaft.“ Ich war recht übermütig und entgegnete: Tagorer bani-i amar jivan, d.h. „Tagores Worte sind ausschlaggebend für mein Leben.“ Zweifellos verstand Gandhiji den Gesamtzusammenhang nicht völlig. Damals verlangte er von uns ferner für jedes Autogramm fünf Rupien für seinen Ashram, was ich auch im Namen meiner Mitschüler entschieden ablehnte, ohne mich jedoch vorher mit ihnen abgesprochen zu haben. Der ausschlaggebende Punkt liegt hier darin, dass ich mich bei meinem frevlerischen Protest einfach an Tagore hielt, der an die biblische Autorität glaubte: „Am Anfang war das Wort.“ Es war, so dachte ich, eine Art poetischer Vergeltung, die ich Gandhiji hier erteilte. In Wirklichkeit aber war ich recht stolz darauf, dies getan zu haben. Selbst heute bin ich von der Tatsache überzeugt, dass für Tagore das Wort – gesprochen oder geschrieben – von äußerster Bedeutung war, woraus das Phänomen Leben entstehen kann.
Dies war die Zeit, in der ich mich dem Marxismus zuwandte. Ein marxistischer Guru aus Kalkutta kam nach Santiniketan, und wir waren bereit, uns von ihm konvertieren zu lassen. Amartya Kumar Sen, jetzt ein Ökonom von Weltruf, und Tanlee, ein chinesischer Freund, der nie mit dem Gedanken spielte, Maoist zu werden, standen mir bei diesem ikonoklastischen Prozess bei.
Während dieser Zeit war die Kommunistische Partei Indiens dabei, sich in den Untergrund zu begeben, und wir drei Jugendlichen hatten immensen Spaß daran, die – gegen die kürzlich erlangte sogenannte Unabhängigkeit Indiens gerichteten – aufwiegelnden Traktate unter den Mühlenarbeitern von Bolpur in Umlauf zu bringen. Für unsere Abenteuer suchten wir Verstecke in den nahgelegenen Dörfern des Distrikts Birbhum.
Damals wurde Majakowski zu meinem bevorzugten Autor, nicht etwa Tagore. Dies war der erste Ansatz, mich zu ent-tagorisieren. Ich sah mich nicht länger als Produkt oder Nebenprodukt Santiniketans. Diese verwirrende Erkenntnis gewann ich, während ich mein Äußerstes versuchte, dem Establishment, genannt Tagore, aus dem Wege zu gehen. Fast alle älteren Bengali-Autoren der 1930er Jahre, die versucht hatten, ihre eigene solipsistische Modernität zu behaupten, indem sie Tagore verunglimpften, kehrten letztendlich zurück, um in Tagore ihren Rückhalt zu suchen.
Ihre schnelle Rückkehr zum Ankerplatz des alten Barden überzeugte mich irgendwie, wenngleich wider-strebend, weiterhin in Santiniketan zu bleiben. Es war an einem solchen Punkt, dass ich in die allegorische Welt der Dramen Tagores eindrang. Darin lag ein Element der Ironie.
Wir waren seit langem der Fesseln der Ritualisierung, deren Anfänge in Santiniketan zu erkennen waren, müde und nannten es bereits Achalayatan (Die ausgediente Einsiedelei) – nach dem Titel des Stückes, das während der Gitanjali-Phase (1910-1914) entstanden war.
Eines Tages wollte Hirendranath Datta, unser Englischlehrer, der durch seine Übersetzung von Lady Chatterley's Lover in Verruf geraten war, dieses Stück aufführen. Subhadra, die Nebenfigur, ein harmloser junger Rebell dieses Dramas, wird von den Ashramiten gezwungen, sich eine lange Zeit der Buße und Reue aufzuerlegen, weil er das verbotene nördliche Fenster geöffnet hatte.
Keiner meiner Freunde wollte diese Rolle übernehmen, da niemand für ein Verbrechen büßen wollte, das keines war. Schließlich erklärte ich mich bereit, diesen Part zu spielen, versagte bei der Probe aber kläglich, da ich an gegebener Stelle einfach zu weinen vergaß. Ich lernte meinen Text wie eine mechanische Puppe mit einer Präzision, die Hirendranath ärgerte. Er überredete mich sogar, hie und da eine Phrase auszulassen und flehte mich geradezu an, meine Trauer durch spontane Tränen zu zeigen, was mir bei der Hauptaufführung dann auch gelang. Noch immer erinnere ich mich mit Nostalgie daran, wie Hirendranath mir in der Pause gratulierte und mich umarmte. Ich aber weinte noch immer bitterlich.
Ich mag Anekdoten nicht und fühle dennoch, dass dieses Beispiel den Aspekt der kathartischen Befreiung in Tagores Dramen beweist.
Zufällig geriet damals eine Kopie von Edward Thompsons Tagore- Studie mit den Randbemerkungen des Poeten in meine Hände. Thompson hatte angemerkt: „Tagores Stücke sind Medien der Ideen und nicht Handlung.“ Dazu kommentierte Tagore darin: „Welch ein stupides Beispiel, gegen Windmühlen anzukämpfen.“
Ich bin überzeugt, dass Tagores Bemerkungen völlig gerechtfertigt sind. Kaler Jatra (Die Reise der Zeit), geschrieben nach dem Besuch des Dichters in Russland, ist voller Handlung, ohne je den Eindruck zu erwecken, dass dieses Stück aus der Feder eines Dichters stammt, dem Worte nahezu alles bedeuteten. Andererseits lassen die Produktionen der berühmten Theatergruppe Bohurupi von Raktakarabi (Roter Oleander), eines symbolischen, gegen die Auswüchse des Kapitalismus gerichteten Stückes, deutlich erkennen, dass Tagores Worte, richtig betrachtet, von Handlung geradezu pulsierend, Bewegung auslösen. Das Problem
entsteht, wenn der Dichter-und-Dramatiker vom Hermetischen zum Hermeneutischen überwechselt und durch Zerreden die Zone zwischen Gesprochenem und Dargestelltem beeinträchtigt. Es ist die Aufgabe der heutigen Dramaturgie, diese Passagen gnadenlos zu beschneiden, so dass die Suggestibilität der Absicht erkennbar wird.
Ich bin froh, dass der Dramaturg-Dramatiker Wolfram Mehring bei seiner Kalkutta-Produktion von Dakghar (Das Postamt), selbst die aussagekräftigste Äußerung: Chup karo abiswasi, katha koyona (Halt den Mund, Ungläubiger, kein Wort mehr!), ursprünglich vom Großvater mit erhobenem Zeigefinger gesprochen, heraus strich. Derart erklärende Äußerungen haben Maurice Maeterlinck, der ein Jahr vor Tagore den Nobelpreis erhielt, aus heutiger Sicht irrelevant gemacht.
Kritiker, die beide Autoren in einem Atemzug nennen, haben die Tatsache vergessen, dass Tagore seinen Produzenten seine dramatischen Texte häufig in verschiedenen Fassungen anbot, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Variationen auf der Bühne darzustellen.
Wenn Tagore – wie Yeats – seine Bühne betrat und mit den Schauspielern diskutierte, so geschah dies nicht als deus ex machina, sondern aus dem Geist des Involviertseins. Und das ist die Erklärung dafür, dass – mag auch seine periodische Anwesenheit gelegentlich die Aura des Familienoberhaupts vorspiegeln – seine eigene Identifizierung mit seinen Figuren, den Kriminellen wie den Vergeistigten, doch möglich ist. Tagore fordert von uns dieses Bemühen um Identifikation. Und damit hat er Erfolg bei den Liedern seiner Stücke mit denen, wie er sagt, „sich Türen öffnen.“
Diese Lieder dienen in seinen Stücken zwei Dingen. Erstens: sie sind wie Bojen auf der Bestimmungsreise der Charaktere, indem sie aufschlussreiche Hinweise geben, wenn Rede und Handlung überflüssig werden. Zweitens: sie bieten eine Erholungspause inmitten der verwirrenden Dichte menschlichen Seins. Sie helfen den Figuren, sich zu einer mysteriösen Reise aufzumachen, was auch beinhaltet, dass der Mensch nicht nur eine Kreatur der Kausalität des Zeit-Raum-Kontinuums ist.
Sich mit einer gegebenen Situation zu identifizieren und sie dann hinter sich zu lassen – das sind die Funktionen der Tagore-Lieder. Sind diese Erfordernisse erfüllt, werden die Lieder – frisch von der Bühne weg – Dauerbestandteil der Bengali-sprechenden Menschen. Tagores Behauptung, dass, sollten auch seine schöpferischen Unternehmungen anderer Genre nicht überdauern, so würden doch seine Lieder der Nachkommenschaft bleiben, scheint mir nicht zu hoch gegriffen. Denn durch seine Lieder wird er – in allen Lebenslagen – zum intimsten Wortführer des bengalischen Volkes. Beginnen sich die Monsunwolken zu sammeln, werden sie die Miya ki mallar nicht nach dem klassischen Raga-Modus anstimmen, sondern sich in die Rabindrischen Lied- Sequenzen dieses Ragas flüchten, in denen der Dichter deren bunte Variationen aneinanderfügte.
Ein Dichter meiner Generation, Sankha Ghosh, konfessionslos, würde beim Ableben eines lieben Freundes Trost in dem dreifachen Totalitätsmuster des Rabindrasangit, gegründet auf Prakriti (Natur), Puja (Verehrung) und Prem (Liebe) suchen und diese Lieder als Gedichte rezitieren. Obschon Rilke Tagore beneidete, hatte er Freude daran, „die Lieder des Inders“ zu lesen, d.h., die von Tagore geschriebenen Lieder. Dabei ließ Rilke die Tatsache außer Acht, dass diese gleichzeitig vom Verfasser selbst komponiert waren. Hier, an dieser Stelle, bleibt mir nichts übrig, als mich zu wundern, dass Heine ungefähr 350 Lieder schrieb, diese dennoch irgendwie unvollkommen blieben, bis ein Schumann oder Silcher einige davon vertonte, wohingegen Rabindranath Tagore, der bedeutendste Heine-Übersetzer in die bengalische Sprache, mindestens 2500 Lieder schrieb und komponierte. In Bengalen werden die Menschen es niemals überdrüssig, diese unzähligen Nischen des weitläufigen Gebäudes seiner Musik zu durchwandern, wobei sie jedoch oftmals die intrinsische Kunst dieser Lieder nicht bemerken. Sie bringen all ihre Stimmungen zum Ausdruck und nähren dabei eine besondere Art Aphasie. Adäquat aber synchronisieren diese Lieder auch ihr Schweigen. Weiterhin lindern, heilen sie ihr Elend, ihre Gebrechen, ihre Qualen. Dieser therapeutische Gebrauch der Rabindra-Songs würdigt sie andererseits sicher etwas herab.
Ihre vielseitige Anwendbarkeit hat sie gelegentlich von ihrem Sockel gestürzt. Was ich darum jetzt versuche, ist, diesen Liedern mit Brechtschem Losgelöstsein und Verfremdung zu begegnen, ohne jegliche therapeutische Motivation.
Sollten diese Texte nicht als Integralsegment des Gesamtkunstwerkes behandelt werden, wie Wagner es bezeichnet haben würde? Integrierte der Dichter sie nicht ebenso wie seine Fiktion in Oper und Tanzdrama – als eine Art untrennbarer Atmosphäre? Sie aus dieser Totalität zum privaten oder kollektiven Gebrauch heraus zu reißen, bedeutete unwiderruflich eine Verfälschung seines Vermächtnisses und gäbe der Entstehung einer monopolisierenden Vendetta Vorschub.
Und genau das geschah und geschieht, nachdem die bengalische Kultur geo-politisch geteilt wurde. Ein Beispiel hier: Während Tagore den Besitz seiner Vorfahren in Selaidaha – jetzt in Bangladesch gelegen – verwaltete, hatte er engen Kontakt mit der Dorfbevölkerung und schrieb – daraus resultierend – eine Anzahl wunderbarer Kurzerzählungen.
Tagores pompöse Geburtstagsfeier im Mai 1990 in Selaidaha war Anlass zu erheblichen Meinungsverschieden-heiten. Ein wichtiger Kritiker aus Bangladesh war der Meinung: „Der Aufenthalt des Dichters in Selaidaha erbrachte eine reiche Ernte an Kurzerzählungen. Die Atmosphäre hier inspirierte ihn zu profiliertem Schreiben, während seines hiesigen Aufenthaltes entstanden nicht weniger als 57 Erzählungen. Sobald er in die öde, wellenförmig verlaufende Ebene von Birbhum/Westbengalen übersiedelte, verebbte seine Kreativität ...“ Wie außerordentlich zutreffend und doch einseitig ist diese Sicht. Bei meiner endgültigen Rückkehr von Santiniketan nach Kalkutta im Jahre 1949 hatte ich ein gutes Gefühl, jetzt eine topographische Distanz zwischen Selaidaha und Santiniketan zurückzulegen. Oder mit anderen Worten, ich war hin- und hergerissen zwischen diesen beiden Zentren des kreativen Schaffens Tagores und konnte, während ich mich zu den weiblichen Charakteren jener Kurzerzählungen hingezogen fühlte, die Dimension der Komplexität der urbanen Figuren, die Tagore während seines Aufenthaltes in Kalkutta, dem dritten Sitz seiner kreativen Vitalität skizzierte, ausloten.
Es war hier, dass Tagore von den seinerzeit gültigen Normen abwich und in das ,,roaring 20th century“ eindrang. Virginia Woolf beobachtete, dass sich um 1910 die menschliche Natur veränderte – so änderte sich auch Tagore, zumindest in seiner psychologischen Fiktion. Tagore war einer der ersten indischen Leser von Freuds Traumdeutung (1915) und schuf in seinem Roman Chaturanga (Vier Teile, 1916) Sachish, eine
männliche Figur nach den Gesichtspunkten des Triebhaft-Libidinösen der Freudschen Psychologie. Dieser Charakter findet keine Ruhe in einer endgültigen Position.
Auch sein weiblicher Gegenpart, Damini, ist nicht länger die Personifikation der archetypischen Perfektion, des lebensbestätigenden Prinzips, wie Tagore sie haben wollte. Diese Frau entwindet sich den kontrollierenden Tentakeln ihres Schöpfers, einem Wächter des Ethos in seinen Reden über Religion, Philosophie und Gesellschaft. Sie steht in einem Niemandsland und bewegt sich somit fort vom Tagoreschen Zentrum der wohlwollenden Gravitation:
Wo es keinerlei Antwort oder Ruf auf einem so grenzenlosen und kalkweißen Boden gibt. (...) Damini stand wie angewurzelt. Hier wurde alles ausgelöscht, um das ursprüngliche Weiß wiederherzustellen. Nur ein großes 'NEIN' lungert zu ihren Füßen.
Jetzt verstehen wir, wie vage Romain Rollands Aussage ist, wenn er sagt, dass Tagore vor allem zurückschreckte, was irgendwie NEIN andeutete.
Es ist auf diesen Trugschluss zurückzuführen, der Tagore als größeren Normenmacher heraus stellte, als er es wirklich war. Somit mussten die meisten Übersetzungen von Tagore-Literatur in Europa scheitern. So wird z.B. die Gedichtesammlung Gitanjali, die keinen Stempel irgendeiner institutionellen Gottheit trägt, in Deutsch zum Lied- Opfer oder zur „Weihgabe in Liedern“. Folglich lässt die schwedische Version den bereits transplantierten Gardener (1913), Örtagardsmästaren (1914), zu Jesus von Nazareth werden, der nach seiner Auferstehung den Frauen als Gärtner erschienen ist. Das ist auch der Grund, weshalb die sensitive Psyche Andre Gides die säkularen Zeilen von Gitanjali „Während du in meinen hypnotisierten Ohren wohnst, möchtest du deine eigene Musik genießen“ mit einem parvis umgibt, was im Französischen den Außenwall einer Kathedrale bedeutet.
Sollte eine Übersetzung nicht eine Herausforderung sein, die kulturelle Matrix des Originals neu zu erfahren, in der der Autor ständig zwischen seinen monistischen Ressourcen und multiplen Wesen oszilliert? Genau das geschah in der letzten Dekade des dichterischen Schaffens Tagores, in welcher der Autor seine eigene Weltanschauung überschreitet und ein anderer wird, nach dem Modus Phoebus-Apollo, dem Gott der Dichtkunst, der die Rohmaterialien von irgendwoher jenseits des bewussten Denkens sammelt. Auch für mich, als Bengale, war es nie leicht, diese Disposition zu verstehen: dieses Verlangen des Dichters, seinen eigenen etablierten Nexus zu verlassen und einzudringen in die nicht einzustufende Stimme des kollektiven Unbewussten. Bei der Vorbereitung der Anthologie Der andere Tagore war ich glücklich, dass Lothar Lutze und ich gemeinsam die Gedichte eines zwischen dem einen und dem anderen rätselhaft gefangenen Dichters auswählten. Ich war verantwortlich für Tagore, den Unwandelbaren, Unveränderlichen, der niemals aufgeben würde und stets im Einklang mit seinem ausgewogenen Universum zu bleiben versuchte, wohingegen Lothar Lutze, der andere und der unvoreingenommene Übersetzer, dem anderen Tagore, dem Wandelbaren, den Vorzug gab, dem Tagore, der sich unbewusst von seiner wohldefinierten Persönlichkeit entfernte. Es war während dieses Zwiespalts – diesem Abwägen, dass wir beide die Größe Tagores entdeckten, die zugleich jenseitig und profan war. Der Tagore- Wissenschaftler Alex Aronson prüfte diese beiden Aspekte, als er besonders die Zusammenfügung der Welten – vergleichbar jenen Hölderlins und Paul Celans – erkannte und hinzufügte, dass diese immense Spannweite bei Tagore inhärent sei.
Für mich ist es jetzt wesentlich, aus dem immensen Kontingent kreativen Schaffens dieses produktiven Autors die quintessentiellen Stücke Tagores zu sondieren. Dabei bevorzuge ich jene Werke, in denen er seiner Kreativität freien Lauf lässt. Nicht, dass ich seine Schriften und Abhandlungen über religiöse, politische, philosophische und pädagogische Themen nicht lese. Tatsache ist, dass ich viel daraus lerne und ihre äußerste Relevanz in unserer verwirrten Nach-Golfkriegs-Welt finde. Doch macht es mir viel mehr Freude, wenn er sich, indem er für Sterblichkeit kandidiert, seiner unerreichbaren Attribute beraubt und spielerisch schafft.
Diese beiden Formen des Selbst, das Instruktive und das Spielerische, sind organisch in ihm. So ersetzt er ganz nach Belieben das eine durch das andere, wechselt sie gegenseitig aus. Er selbst nennt das in seiner Atmaparichay (eigene Identität) betitelten Autobiographie paradoxerweise die Einheit der eigenen Gegensätze. Wenn er jetzt – in einer diskursiven Prosa – zum optimistischen Pfadfinder wird, verliert er im nächsten Augenblick spontan seine Richtung in seinem Vers-Buch und wird wertfrei.
Meine Sympathie gilt dem Letzteren. Meine Freunde warnen mich, wenn ich in seiner Prosa-Fantasie Sey (Er) schwelge, die er vier Jahre vor seinem Tod schrieb. Sie erinnert mich an Kafkas ER, eine exquisite Aphorismensammlung, und dennoch finde ich Tagores Sey mehr kafkaesque in seinem rudimentären Eintauchen in die Tiefen des Unterbewussten, wo er „sie“ wird und dennoch „es“, und schließlich das egoistische Sublime der ersten Person verwischt.
Das führt mich zu Tagores Malereien, die sich (zwischen 1928 und 1940 entstanden) auf ca. 2000 Bilder belaufen und, soweit es die Anzahl betrifft, mit seinen Liedern wetteifern. Über den Anfang mit zögernden Kalligraphien und Kritzeleien, flüchtigen, asymmetrischen Experimenten ging er zu kräftigen Farben über. Hier entstand eine andere Welt voller elementar vermischter Entitäten, wo undurchdringliche Dunkelheit vorherrscht.
Darin wird die Entschiedenheit zum Zweifel, ein alter Mann zur Frau, eine Frau zum Tier. Dabei riskiert der Dichter als Maler Unbehagen bei jenen, die ihn als Gurudeva verehren. Und hier entblößt sich der König ästhetischer Werte allem majestätischen Drum und Dran und manifestiert seinen Genius als Mit-Sterblicher und nicht als Super-Nova.
Maler, dann auch Musiker, vor allem aber Autor – Poet, Dramatiker, Denker –, stets bereit, seiner eigenen Meinung zu widersprechen: mein Tagore, der Tagore, den ich von Jugend an während meines Lebens erfahre, umspannt die ganze Weite an Genre und Stoff. Ein fruchtbarer Geist, der sich mit Einfühlsamkeit und Sicherheit in einem gefährlichen Balanceakt auf dem Höhengrad der Sensibilität bewegen kann und dennoch bereitwillig in den Abgrund springt. Weder Heiliger noch Guru: Er bleibt für mich sowohl eine künstlerische als auch eine menschliche Herausforderung.
Überarbeitete Fassung einer Rede von Alokeranjan Dasgupta auf dem Tagore- Symposium,
das im Rahmen der Indienfestspiele im April 1992 in Darmstadt stattfand
Erhältlich in jeder guten Buchhandlung oder direkt beim Verlag unter Bestellungen!
